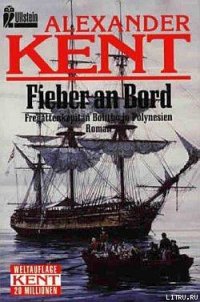Donner unter der Kimm: Admiral Bolitho und das Tribunal von Malta - Kent Alexander (читать хорошую книгу полностью txt) 📗
«Sehr entgegenkommend von Ihnen«, meinte Keen.»Wenn ich nur gewu?t hatte.»
Bolitho lachelte ernst.»Sie hatten trotzdem so gehandelt.»
An Deck stampften viele Fu?e, und Taljen quietschten, als der Wachoffizier die Manner an die Brassen rief.
Auf einem uberfullten Kriegsschiff konnte eine einzige Frau vieles bedeuten, nicht zuletzt Ungluck. Landratten mochten uber solchen Aberglauben spotten, aber wer zur See fuhr, wurde bald eines besseren belehrt.
«Suchen Sie die junge Frau auf, Val, und sagen Sie mir dann, was Sie von ihr halten. In Gibraltar konnen wir sie auf die Philomela verlegen. Andernfalls wurde sich Latimer wahrscheinlich an ihr rachen.»
Keen machte Anstalten, sich zuruckzuziehen. Er hatte ohnehin vorgehabt, das Madchen zu besuchen und sich beim Arzt nach ihm zu erkundigen. Ganz gleich, was es in seinem jungen Leben getan hatte, die Qual und Erniedrigung einer Auspeitschung verdiente es nicht.
Bolitho wartete, bis die Tur sich geschlossen hatte, und nahm dann wieder unter den Heckfenstern Platz. Erneut dachte er an Falmouth, seine frohe Heimkehr, und wie er seine einzige, neugeborene Tochter Elizabeth so ungeschickt im Arm gehalten hatte, da? er von Belinda ausgelacht worden war.
Bolitho hatte immer verstanden, da? es fur jede Frau schwer sein mu?te, uber die Schwelle seines Hauses zu treten. Es barg zu viele Schatten und Erinnerungen, zu hohe Erwartungen. Belinda war nur in Cheneys Fu?spuren getreten, oder so mu?te es ihr zumindest vorgekommen sein.
Am hartesten hatte Bolitho die Entdeckung getroffen, da? Cheneys Portrat — das Gegenstuck zu dem, das sie von ihm hatte anfertigen lassen — aus dem Raum, in dem die beiden Bilder nebeneinander hingen, entfernt worden war. Cheney vor dem Hintergrund der Landzunge, mit Augen so grun wie die See, und er in seinem Rock mit den wei?en Aufschlagen als der junge Kapitan, den sie so sehr geliebt hatte. Sein Portrat hing nun bei den anderen neben dem seines Vaters, Kapitan James Bolitho.
Er hatte geschwiegen, weil er Belinda nicht verletzen wollte, aber gestort hatte ihn der Vorfall doch. Er kam ihm wie Verrat vor.
Immer wieder sagte er sich, da? Belinda ihm nur helfen, anderen zu verstehen geben wollte, wie wertvoll er fur sein Land war. Doch er war in Falmouth zu Hause, nicht in London.
Seufzend wandte er seine Gedanken Allday zu. Der hatte vermutlich die gespannte Atmosphare in Falmouth gespurt. Doch zeigte er nicht, was er davon hielt. Oder vielleicht war er so mit der Entdeckung seines Sohnes beschaftigt gewesen, da? ihm keine Zeit fur Spekulationen blieb.
Bolitho stellte sich die beiden vor, wie sie hier in der Kajute vor ihm gestanden hatten: Allday kraftvoll und stolz in seiner blauen Jacke mit den Goldknopfen, den Kopf lauschend geneigt, als Bolitho zu dem jungen Matrosen John Bankart sprach.
Bolitho entsann sich, wie Allday vor zwanzig Jahren als Opfer einer Pre?patrouille an Bord seiner Fregatte Phala-rope gebracht worden war. Damals war er wie dieser junge Matrose gewesen: klare Augen und ein ehrliches Gesicht mit einer Andeutung von Aufsassigkeit. Ohne gro?es Zogern hatte er sich von der Pre?patrouille verpflichten lassen. Das Leben auf dem Bauernhof gefiel ihm nicht, und zudem wu?te er, da? es ihm als Freiwilligem auf einem Kriegsschiff besser gehen wurde als einem Zwangsverpflichteten.
Seine Mutter war ledig gewesen. Allday hatte angedeutet, der Bauer habe seine Mutter oft unter der Drohung, sie und ihr Kind andernfalls vor die Tur zu setzen, mit ins Bett genommen. Das hatte in Bolitho einen Nerv beruhrt: Die Erinnerung an Adams Eintreffen auf dem Schiff, als er nach dem Tod seiner ledigen Mutter den ganzen Weg von Penzance zu Fu? zuruckgelegt hatte. Die Parallele war zu offensichtlich.
Alldays Sohn hatte sich bereits als guter Seemann entpuppt, der reffen, splei?en und steuern konnte, und zwar ebensogut wie andere von hoherem Rang und langerer Dienstzeit. Als zweiter Bootsfuhrer wurde er nur wenig Kontakt mit dem Admiral haben, sondern sich mehr um die Instandhaltung der Barkasse und Botengange kummern und Allday allgemein zur Hand gehen. Furs erste fand Bolitho diese Losung brauchbar.
Er stand auf und ging in seine Schlafkammer, wo er nach kurzem Zogern eine Schublade aufzog und die hubsche ovale Miniatur Cheneys herausnahm. Der Kunstler hatte ihren Ausdruck perfekt getroffen. Bolitho legte das Bild zuruck unter seine Hemden. Was ist nur mit mir los? dachte er. Ich bin glucklich verheiratet, habe eine zehn Jahre jungere Frau und nun eine reizende Tochter. Und trotzdem… Er wandte sich um und ging zuruck in die Tageskajute.
Wenn sie erst zur Flotte gesto?en waren, wurde sich alles andern. Dann erwarteten ihn Gefechte, Gefahren und die Fruchte des Sieges. Er versuchte, seine Gedanken auf die kommenden Monate zu konzentrieren, und fragte sich, wie Lapish reagieren wurde, wenn seine Fregatte zum ersten Mal kampfen mu?te. Doch statt dessen dachte er an das Portrat, das aus dem Salon verschwunden war, und wunschte sich plotzlich, er hatte es mitgenommen.
Tief unter Bolithos geraumigem Quartier mit der vergoldeten Heckgalerie lag das stickige Krankenrevier im fensterlosen Orlopdeck unter der Wasserlinie. Schwankende Laternen lie?en dunkle Schatten uber die Wande huschen, und die machtigen Deckenbalken waren so niedrig, da? man nicht aufrecht stehen konnte. Seit das Schiff erbaut worden war, hatte das Orlopdeck kein Tageslicht mehr gesehen.
Winzige Kammern saumten den gro?en Raum in der Mitte, in denen die Decksoffiziere fast ohne Bewegungsfreiheit ihre Privatsphare zu wahren versuchten. Nicht weit davon fuhrten die Midshipmen, von denen erwartet wurde, da? sie sich beim Schein eines in olgefullten Muscheln oder alten Dosen schwimmenden Dochts auf die Offiziersprufung vorbereiteten, ihr chaotisches Leben. Sie alle teilten das Deck mit dem Pulvermagazin, wo schon ein einziger Funke katastrophal wirken mu?te. Unter ihnen enthielten die gro?en Frachtraume alles, was zum Betrieb des Schiffes notwendig war und es auf Monate hinaus unabhangig machte.
Das Krankenrevier ganz hinten am Fu? des Niedergangs wirkte mit seinem wei?en Anstrich und den Regalen voller Glaser und Flaschen vergleichsweise licht. Keen schritt darauf zu und senkte automatisch den Kopf, um sich nicht an den Balken zu sto?en; seine Epauletten glitzerten, als er eine Laterne nach der anderen passierte. Dunkle Umrisse und verschwommene Gesichter tauchten in der Dusternis auf, dieser von See und Himmel so weit entfernten Welt, und verbla?ten wieder.
Keen sah James Tuson, den Schiffsarzt, mit seinem Assistenten sprechen, einem gro?en blassen Mann von den Kanalinseln, der Carcaud hie?. Letzterer war mehr Bretone als Englander, aber intelligent und des Lesens und Schreibens machtig. Keen wu?te, da? sich Tuson, der schon Arzt auf der Achates gewesen war, sehr um seinen schlaksigen Helfer bemuhte und ihm alles beigebracht hatte, was er selbst wu?te. Die beiden spielten sogar Schach.
Keen mochte den silberhaarigen Tuson, obwohl er ihn auch jetzt nicht genauer kannte als auf dem vorigen Schiff. Er war ein guter Chirurg, zwanzigmal besser als die meisten seiner Kollegen. Doch er blieb fur sich, was in dieser wimmelnden Welt zwischen den Decks nicht einfach war, und kam nur zu den Mahlzeiten in die Messe.
Ein Seesoldat, dessen Kreuzbandelier im schwachen Licht sehr wei? wirkte, nahm Haltung an und bedeutete Tuson, da? der Kommandant gekommen war. Es war eine kluge Vorsichtsma?nahme, an der Tur einen Posten aufzustellen, dachte Keen. Die Besatzung war nun schon seit Monaten fast ohne Unterbrechung auf See. Da schwebte jede Frau in Gefahr, und eine, die als Gesetzesbrecherin abgestempelt war, ganz besonders.
Tuson murmelte etwas, und sein Assistent verschmolz mit dem Schatten.
«Wie geht's ihr?«fragte Keen.
Tuson rollte sich die Hemdsarmel herunter und dachte uber die Frage nach.